Blog
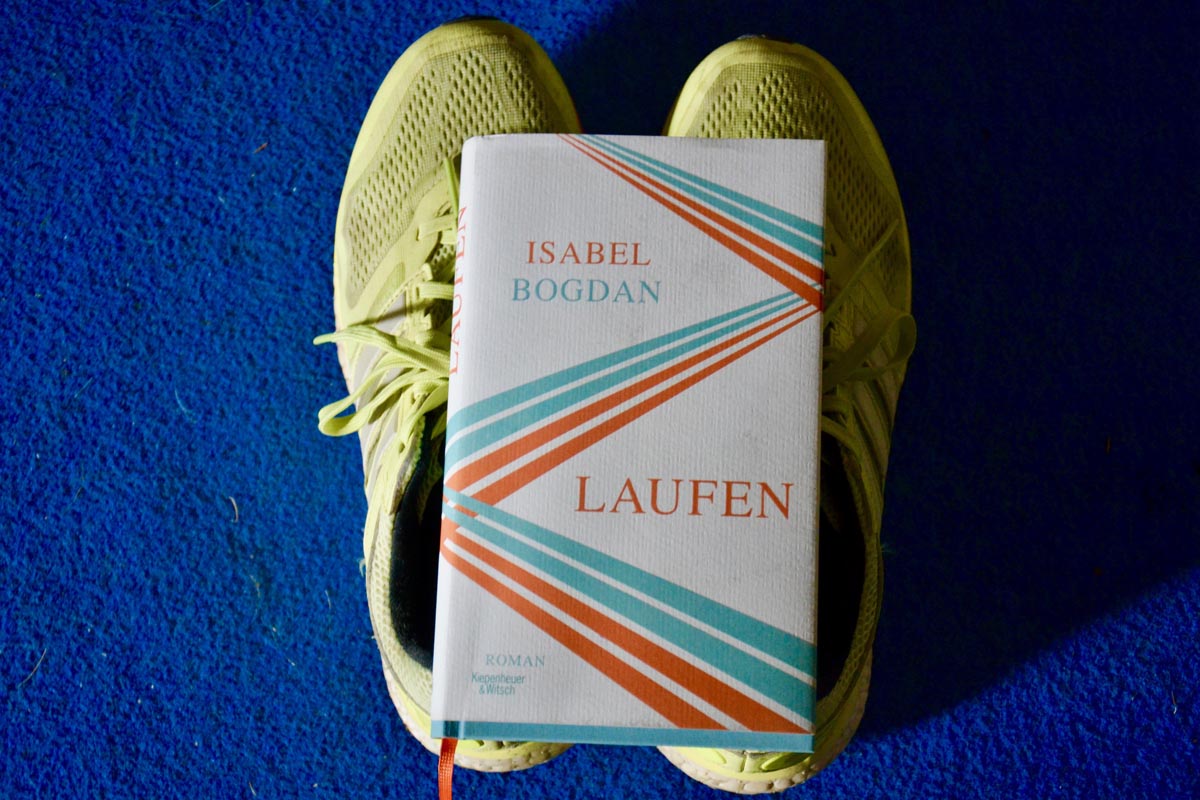
Atemlos und sehr nah dran: Laufen
…du konntest immer Eis essen, auch im Winter. Wie kann man denn Dinge gerne tun und trotzdem nicht mehr leben wollen? Du wirst jetzt nie wieder Eis essen, hast Du da mal drüber nachgedacht? Ich muss langsamer laufen, es ist zu heiß, die Strecke ist zu lang. Ein ein aus aus aus. (Isabel Bogdan: Laufen)
Auf Seite 94 liest man es zum letzten Mal, dieses „Ein ein aus aus aus“, vorher dutzende Male, eine Mischung aus Anfeuerungsruf, Selbstbefehl, Trotz, immer dann, wenn die Erzählerin aufgeben will. Sich der Erschöpfung hingeben, nicht nur der des Körpers. Auch die Seele der Frau ist müde, wund, ein Loch klafft darin, wie sie es einmal ausdrückt, dort, wo der Mann war. Das Leben vorher. Bevor er, der an Despressionen litt, sich das Leben nahm. Um ihr Leben ohne ihn, die Schuldgefühle, die Sehnsucht, zu meistern, ja, um dieses neue Leben überhaupt zu finden, beginnt sie zu laufen.
Ich selber laufe nicht, auch wenn es das Bild suggeriert. Sportschuhe mussten aber drauf, denn ich fühlte mich nach der Lektüre wie nach einem Marathon (wie ich mir vorstelle, dass man sich fühlt). Atemlos. Vieles tat weh. Glücklich. Klarer. Klüger.
Leiser Wendepunkt
Auch die Erzählerin läuft einen kleinen Marathon, den Alsterlauf, 10 Kilometer. Ihre Freundin Rike hat sie einfach angemeldet, und was die Erzählerin eigentlich nicht wollte, gerät zum Wendepunkt. Wenn auch so winzig, dass man ihn zunächst übersieht. Es ändert sich nichts – außer das Tempo. Erst auf Seite 135 taucht das Atmen wieder auf, diesmal aber nicht als rastloser, gequälter Befehl, sondern eher wie ein Mantra. Das in Folge seltener erklingt, während die Verlangsamung der Gedanken weiter geht. Die Erzählerin kommt zu sich.
Ein-at-men aus-at-men aus-at-men, ich muss aufhören, über Sex nachzudenken, aber Mann, wie ich das vermisse, wie ich das schon vermisste habe, als Du noch da warst. Dein Duft ist weg, dein Schlafanzug, riecht nicht mehr nach Dir, dein Gesicht ist noch da, manchmal, und manchmal höre ich Deine Stimme noch.
Man kann sich gegen das lange Zeit atemlose Lesen, später immer noch schnelle Lesen, kaum wehren, der Text zieht einen mit, man hält Schritt, rennt, fliegt mit der Erzählerin über die tausenden Kommas, ein ein aus aus aus aus, doch sollte man sich unbedingt nach dem Ende des Laufs noch einmal in Ruhe dem ersten, rasanten Teil widmen. Nein, dem ganzen Buch. Denn überall liegen da Perlen von Wörtern und Gedanken, die man womöglich im ersten Durchlauf nur kurz hat aufblitzen sehen, am Wegrand. „Du machst mir nie wieder das Kleid zu, das war eine meiner liebsten Paargesten“, heißt es einmal. Paargeste. So viel drin, in diesem Bild, in diesem Wort. Intimität. Alltag. Zärtlichkeit. Auch „Wintertrostgedanke“ ist so eine Wortperle:
Vielleicht ist die Haut an den Füßen das Einzige, was im Sommer härter wird und im Winter weicher, der ganze restliche Körper wird im Sommer weich, wenn es warm ist, nur die Füße werden härter, und vielleicht sollte ich mir den Gedanken aufheben für den Winter, „wenigstens werden meine Füße wieder weich“, das könnte ein schöner Wintertrostgedanke sein, weil ich darüber werde lachen müssen.
Kreisdenken? Ja und nein
Was an dieser Stelle beispielhaft (denn es gibt viele solcher Passagen) offensichtlich wird: Der Sinn fürs Absurde, die feine Beobachtungsgabe. Trotz der Trauer, Wut, Einsamkeitsattacken und Fassungslosigkeit schlingert die Erzählerin nicht nur um sich. Im Gegenteil: Fortwährend bricht sie aus ihrem Kreisdenken aus, beobachtet sie andere Menschen, malt sich deren Leben, Vorlieben und Sorgen aus. Denkt über Ginkobäume nach und darüber, warum der ältere Herr auf dem Sportplatz barfuß läuft. Sinniert über Kuschelpartys und Worte:
Oder man kuschelt mit einem und stellt erst zu spät fest, dass er unangenehm riecht oder dummes Zeug redet und dann muss man mitten im schönsten Gekuschel plötzlich sagen, ach nee, lieber doch nicht, das ist ja fürchterlich, kuscheln muss sich aus der Situation ergeben, oder man muss sich kennen, mir fallen eher ein bis vier Freunde ein, mit denen ich kuscheln wollen würde, und was ist „kuscheln“ überhaupt für ein Wort, wahrscheinlich wird auf diesen Partys auch viel „geschmunzelt“.
In den Exkursen über Wörter, ihren Klang und was sie transportieren, neben dem, was sie benennen, erkenne ich die Übersetzerin Isabel Bogdan. Vor einem Jahr traf ich sie in Hamburg, um anlässlich des Weltübersetzer-Tages, auch genannt „Hieronymus-Tag“, am 30. September mit ihr über diese Arbeit zu sprechen. Am 30. September, an dem weltweit die Arbeit der ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen gewürdigt wird und diese auf ihre oft so dürftig gewürdigte Arbeit aufmerksam machen, erschien mein Porträt in der Berliner Zeitung.
Über Jane Gardams Bücher, die Isabel Bogdan seit Jahren ins Deutsche übersetzt, das Glück des Wortsuchens und –findens, Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit der Übersetzer, Honorare und natürlich ihren Bestseller „Der Pfau“ kamen wir irgendwann auch auf ihr damals noch lange nicht beendetes neues Buch zu sprechen. „Keine weitere fluffige Komödie“ schreibe sie, sagte Isabel (wir duzten uns recht schnell), „etwas völlig anderes“ als der „Pfau“. Und dass sie aufgeregt sei. Wie die Leser aufnehmen würden.
Was sie eint
Nun liegen zwischen der köstlichen Komödie um die Banker-Gruppe, die zum Team-Building ins schottische Nichts fährt und dort einen Pfau kennenlernt, der nur um weniges kurioser ist als die angereisten Charaktere, und „Laufen“ tatsächlich Welten. Aber. Während ich mit der Erzählerin litt und zürnte, sehnte und fragte, weinte und mich freute, mich wunderte und amüsierte – fand ich doch eine Verwandtschaft zwischen beiden Büchern. Nicht inhaltlich. Aber im Ton, der, leicht im Sinne von zart, Details, Regungen, Gefühlsanflüge, Stimmungswechsel und unsichtbare Veränderungen in der Atmosphäre sichtbar macht, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt.
Und im Humor, diesem feinen, oft selbstironischen Humor, mit dem die Figuren sich und andere zu begreifen vermögen. Denn wie schon angedeutet, auch der Erzählerin in „Laufen“ ist der Sinn für’s Kuriose und Komische nicht verloren gegangen. Auch nicht – und dafür liebt man sie so sehr, dass es einem immer wieder ganz eng in der Brust wird und man sie lachend in den Arm nehmen möchte – an sich selbst. Sie wundert sich über sich, schilt sich, grinst über sich, schämt sich, fängt sich wieder.
Endlich keine Zumutung mehr sein, ich habe lange genug schwitzend und stinkend zwischen meinen Freunden gestanden, wie hält Rike es überhaupt mit mir aus, und die Mohl (die Therapeutin, Anm. BW), wie hält die es den ganzen Tag mit solchen Zumutungen wie mir aus, wie erträgt man denn so was, den ganzen Tag sitzen Leute bei ihr, die eine Macke haben (…) bestimmt erzählen ihr alle dauernd das Gleiche und sie muss so tun, als wären das ganz individuelle Probleme, oder vielleicht auch nicht, sie sagt ganz oft, dass das alles völlig normal ist, und das hilft tatsächlich ein bisschen, dass der Schmerz zwar ganz allein meiner ist, ich aber nicht die einzige bin…
Was man lernt
Die Passage, die einem Verlust, Trauer und das Gefühl der Aussichtslosigkeit, des Für-immer in so einfachen, eindringlichen Worten nahebringen, endet mit diesen unvergesslichen Worten über das Wesen des Schmerzes nach dem Tod eines geliebten Menschen:
Man wird ihn ja nicht los, aber vielleicht kann man ihn in ein Regal stellen und da stehen lassen, statt ihn immer mit sich herumzuschleppen. Er wird nicht besonders schön aussehen, aber so ein Herz ist ja auch kein Einrichtungsmagazin.
Das meine ich mit dem trockenen Humor, der beiden nicht verloren gegangen ist. Der Erzählerin nicht durch den Verlust ihres Geliebten und Gefährten, Isabel Bogdan nicht durch ihren Wechsel ins ernste Fach. Trauer und Witz, das geht zusammen. Wenn man beidem Raum gibt.
Man lernt so viel in diesem Buch, nicht nur über die heilende Kraft des Laufens, das – finde ich – stellvertretend für viele Möglichkeiten steht, etwas und sich zu überwinden. In dem man etwas schafft. Kämpft. Schwäche und Schwächen zulässt. Schmerzen aushält, indem man sie ansieht. Sie spürt, statt sie zu betäuben oder zu leugnen. Das Kapitel über den Alsterlauf endet so:
Ich bin zehn Kilometer am Stück gelaufen. Zehn Kilometer. Am Stück. Durchgelaufen. Ich bin fix und fertig., ich habe es geschafft, ich habe Freunde, ich habe ein Apfelstückchen in der Hand. Ich habe es geschafft. Ich kann alles schaffen.
Groß und leicht
Man lernt über die Kraft der Freundschaft – Rike und die Musiker-Freunde will man auch ständig umarmen –, die Bedeutung von Nähe und Körperkontakt, über die Stabilität, die ein geliebter Beruf verleihen kann, über die Macht der Depression und die Macht des Vergebens, auch sich selbst.
Große Themen sind das, doch nie wird der Ton gefühlsdusselig oder bedeutungsschwer. Die Laufende spricht mit sich und dem Leser, als ob die Worte, die Erinnerungen, die Gedanken und Beobachtungen gerade im Moment des Sprechens aus ihr heraussprudelten. Lange Zeit atemlos – Ein ein aus aus aus aus – und dann immer ruhiger werdend. Ein-at-men aus-at-men aus-at-men. Man macht es mit. Ob man läuft oder nicht. Und war lange keiner literarischen Figur so nah.
Isabel Bogdan: Laufen. Kiepenheuer&Witsch, 208 Seiten, ISBN: 978-3-462-05349-4
Liebe Barbara
Du sorgst einmal mehr dafür, dass es nicht genügend Regale gibt für die Bücher, die man unbedingt lesen will. Es könnte auch ein Titel mehr sein, über den ich auf der Buchmesse mit Kiwi reden sollte, was meinst Du?
Lieber Wolfgang, ich will halt nicht allein sein mit dem Problem der fehlenden Regale… Und ja, unbedingt. Liebe Grüße!